Martin Stranzl spielte in seiner gesamten Profikarriere im Ausland. Im Sautanz-Interview teilt er seine Erfahrungen aus seiner Zeit in Deutschland, Moskau und warum er mit seiner Familie zurück ins Burgenland zog.
Von Clemens Faustenhammer
Kannst Du Dich noch an den Beginn Deiner Reise aus der Kindheit erinnern? Wie war das damals im Jahr 1986 im Südburgenland?
Martin Stranzl: Als ich mit der Volksschule in Güssing begann, spielten meine Freunde Fußball. Ich schloss mich den Kumpels an. Im Verein hatte ich gute Trainer im Nachwuchs, sodass ich stets mit viel Freude Fußball spielte. Damals übte ich verschiedene Sportarten aus. Neben Fußball machte ich Leichtathletik in der Sporthauptschule Güssing und spielte auch Tennis mit Leidenschaft. Mit 14 Jahren stand ich vor der Entscheidung, welchen Sport ich mit vollem Fokus weiterverfolgen sollte. Nach der erstmaligen Einberufung in die österreichische U-15-Nationalmannschaft war die Sache entschieden…
Zu dieser Zeit warst Du schon im BNZ Burgenland?
Ja. Mit 12 Jahren pendelte ich anfangs einmal, später zweimal die Woche zum Training nach Eisenstadt. Für eine normale Trainingseinheit von 90 Minuten fährst du hin und retour gut drei Stunden mit dem Auto. Mir ist bewusst, dass die besondere Geographie des Burgenlands keinen zentralen Standort begünstigt. Die Situation verlangte für einen Schüler wie mich aus dem Südburgenland ein hohes Maß an Selbstorganisation. Um 16 Uhr wurde ich von der Schule abgeholt, mit dem Bus ging es von Güssing und später von Stegersbach in den Norden und spätestens um Mitternacht war ich zuhause. Rund 35 Jahre später hat sich daran kaum etwas geändert. Es gibt zwar die LAZ-Standorte wie in Güssing, jedoch müssen die Jungen Auswahlspieler nach Mattersburg zum Training fahren. Von der finanziellen Belastung her sind heute sogar sämtliche Reisekosten durch die Eltern zu decken.
Da mutet man einem Teenager im Bereich Selbstorganisation schon recht viel zu. Wie war das für Dich mit der Schule?
Damals waren meine Eltern beide berufstätig. Glücklicherweise gab es die Großeltern, wo ich nach der Schule zum Mittagessen vorbeikam. Das Lernen im Bus war Standard. Ein gewisses Maß an intrinsischer Motivation war sicherlich mein Vorteil, um die Schule recht souverän zu absolvieren. Bei all den tagtäglichen Herausforderungen war die frühe Erfahrung mit einem selbstorganisierten Zeitmanagement für die spätere Karriere im Ausland positiv.
Ein erstes Highlight Europameisterschaft U16 im Jahr 1996 unter Trainer Paul Gludovatz. Welche Erinnerungen hast Du an ihn?
Paul Gludovatz war ein sehr fordernder Trainer und direkt in seiner Ansprache. Das schätze ich als Grundeinstellung. Als Spieler wusste man sofort, woran man bei ihm ist und was er von dir konkret erwartete. Die eigentliche Entwicklung als Spieler erfolgt jedoch im Verein. Da hatte ich in Güssing mit Robert Hazivar und Manfred Luisser zwei Trainer, die mich prägten. Später im BNZ Burgenland war diese wichtige Trainer-Persönlichkeit Peter Herglotz.
Generell konnte ich aus dieser Zeit und im späteren Verlauf während der Profikarriere viele Dinge mitnehmen, die mich heute als Person gesamthaft ausmachen. Persönliche Reflexion, geradlinige Gesprächsführung und Wertschätzung für das Gegenüber sind elementare Learnings. Eine spezifische Situation aus differenzierter Perspektive zu betrachten, ist eine kritische Fähigkeit, um sich eine fundierte Meinung zu bilden. Natürlich machte ich als Spieler weniger positive Erfahrungen mit Vorgehensweisen von manchen Trainern, die ich als Coach nicht anwenden würde. In den 1990er Jahren war der Umgang mit Individualisten oder sogenannten „Freigeistern“ bedenklich. Solche Spieler können durch ihre individuellen Fähigkeiten den Unterschied am Platz ausmachen. Ich habe es selbst erlebt, dass man solche Spieler innerhalb der Mannschaft als Sündenbock bei Niederlagen darstellte, als wäre der Rest des Teams nicht für den Erfolg bzw. Misserfolg verantwortlich.
Es folgte im Februar 1997 Dein Wechsel zu den Löwen nach München. Wie siehst Du diesen bemerkenswerten Wechsel mit nun knapp drei Jahrzehnten Abstand?
Der Weg zu 1860 München war dahingehend dem Umstand geschuldet, dass wir in der Jugendnationalmannschaft gegen die Großen wie Deutschland, Frankreich oder Niederlande meistens ziemlich abgebissen haben. Ich fragte mich, warum diese Nationen besser als wir waren. Womöglich lag dies an der Arbeitsweise in der Jugend. Kurz gesagt habe ich damals den Entschluss getroffen, mein Glück im Ausland zu versuchen, auch wenn diesen Schritt nicht jeder in Österreich nachvollziehen konnte.
Gab es damals eine Bezugsperson im Verein?
Ich hatte damals keine spezielle Kontaktperson im Verein. Für mich steht nach wie vor das Spiel bzw. der Sport im Vordergrund. Als ich später zu den Profis kam, gab es mit den anderen österreichischen Mitspielern stärkeren Kontakt. In der Jugend fokussierte ich mich auf meine eigene Leistung. Um den Rest wie Gastfamilie, Schule etc. kümmerten sich meine Eltern.
Du hast über 250 Bundesligaspiele im deutschen Oberhaus absolviert. Ich kann mir vorstellen, dass durch diese vielen Jahre in Deutschland eine besondere Bindung zu unserem nördlichen Lieblingsnachbarn entstanden ist. Welches Bild von Deutschland hat sich bei Dir eingeprägt? Und wie hat Deutschland vielleicht Dich geprägt?
Eine übergeordnete Verbundenheit zu Deutschland würde ich nicht besonders hervorheben. Wohl am ehesten war das noch in Bayern der Fall, was wohl auf die kulturelle Nähe zu Österreich zurückzuführen ist. Insgesamt ist Deutschland ein sehr großes Land mit einer riesigen Fußballkultur und Geschichte. Egal bei welchem Verein ich spielte, durfte ich diese unvorstellbare Leidenschaft der Fans mit ihrem Verein kennenlernen. Neben den sehr professionellen Rahmenbedingungen passte wohl auch die Direktheit zu meinem Naturell als Spieler – im Gegensatz zum in Österreich verbreiteten „lässig“ oder „leiwand“.
Fünf Jahre hast Du für den Rekordmeister Spartak Moskau gespielt. Welche Eindrücke von Russland haben sich bei Dir nachhaltig festgesetzt?
Was hängen blieb war zunächst ein Reality-Check mit dem Ergebnis, dass im Endeffekt vieles anderes war als ich davor hierzulande über Russland hörte und wie das Land bei uns dargestellt wurde. Vor der fixen Verpflichtung konnte ich mir weder von Russland noch Moskau einen Eindruck verschaffen. Die Vertragsverhandlungen mit der sportlichen Führung von Spartak fanden schließlich in Wien statt. Für mich stand im Vordergrund wieder fix auf der Innenverteidiger-Position zu spielen, was in den letzten Monaten beim VfB Stuttgart unter Trainer Giovanni Trapattoni kaum der Fall war. Neben der wirtschaftlichen Perspektive bei Spartak spielte auch der Faktor Champions League eine ausschlaggebende Rolle für den Wechsel. Insgesamt durchlief der russische Fußball damals eine Modernisierungswelle. Besonders viel Geld investierten die Vereine in neue Stadien und in die Infrastruktur. Was mir vor allem in Erinnerung blieb, sind die enormen Distanzen innerhalb Russlands in verschiedenen Zeitzonen. Bis auf die Stadtderbys und die Busreise nach Ramenskoje, was ebenso in der Oblast Moskau liegt, absolvierten wir sämtliche Auswärtsreisen mit dem Flugzeug.
Wie verlief als Familie eure Eingewöhnung erstmals außerhalb des deutschsprachigen Kulturraums?
Aufgrund der langen Auswärtsreisen, die sich oft über mehrere Tage zogen, blieb meine Frau in Moskau, während ich mit der Mannschaft unterwegs war. Wenn wir unter der Woche im Europacup spielten, kam es durchaus vor, dass ich für ein oder zwei Wochen nicht nachhause kam. Ähnlich verlief die Vorbereitungsphase mit Trainingslagern im Ausland. Als unser Sohn zuhause in Österreich geboren wurde, konnte ich glücklicherweise dabei sein. Allerdings sah ich nach der Geburt meine Familie für sechs Wochen nicht, weil sich das Verfahren mit dem Visum so lange hinzog. Das war eine harte Zeit, wie sich wohl alle, die selbst Kinder haben, vorstellen können. In der Phase als Jungfamilie bekamen wir von unseren Eltern viel Unterstützung. Schon während der aktiven Karriere übernahm meine Frau das Familienmanagement, wofür ich sehr dankbar bin.
Gibt es aus Deiner Moskauer Zeit noch Personen, zu denen Du heute Kontakt hast?
Den damaligen Generaldirektor Sergej Schawlo, der in den 1980er Jahren bei Rapid spielte, treffe ich hin und wieder, wenn er seine Familie in Österreich besucht. Ansonsten gibt es keinen Kontakt nach Russland.
Ein für Außenstehende überraschendes Ende Deiner Zeit im Team folgte 2009. Für manche werden die Nuller-Jahre als eine „bleierne Zeit“ für das österreichische Nationalteam empfunden. Wie lautet Dein Resümee als 56-facher Nationalteamspieler?
Mein sehr früher Wechsel zu 1860 München wurde von manchen Personen im österreichischen Fußball sehr kritisch beäugt. Wenn ich mir die heutige Nationalmannschaft anschaue, fühle ich mich bestätigt, dass der regelmäßige Einsatz von österreichischen Spielern in einer der Top-5-Liga in Europa letztlich unser Team kompetitiver macht. Zu meiner aktiven Zeit war ich einer der wenigen Legionäre im Nationalteam. Wir hatten ein gutes Zusammenleben, doch die Qualität im Vergleich zu heute war nicht am selben Level. Die Konsequenz daraus war, dass wir mit Ausnahme der Heim-Europameisterschaft nie an einem Großturnier teilnahmen. Auch das Ausscheiden aus dem Turnier 2008 war eine herbe Enttäuschung. Dennoch erinnere mich an die vielen positiven Emotionen und der unglaublichen Euphorie bei den Spielen im Ernst-Happel-Stadion. Die letzte Phase unter Karel Brückner war klassisch österreichisch „zwischen Himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt“. Wir gewinnen zum Start der WM-Qualifikation gegen Frankreich, verlieren aber auswärts in Litauen und remisieren auf den Faröer-Inseln.
Abseits dieser Erfahrungen bin ich glücklich darüber, dass ich die Ehre hatte mit Andreas Herzog, Toni Polster, Didi Kühbauer, Thomas Flügel, Harald Cerny oder Markus Schopp zu spielen. Allesamt starke Persönlichkeiten, die dem Spiel der Nationalmannschaft ihren Stempel aufdrückten.
Du genießt noch heute ein hohes Standing in Deutschland. Gibt es noch Berührungspunkte nach München, Stuttgart oder Gladbach?
In letzter Zeit pflege ich wieder etwas intensiver den Kontakt nach Stuttgart über die Legendenmannschaft, um die sich mein ehemaliger Mitspieler Cacau kümmert. Im Zuge meiner Sportmanagement-Ausbildung besteht eine intakte Verbindung nach Gladbach, wo ich ab und zu vorbeischaue, um Einblicke in die verschiedenen Bereiche eines Profivereins in einer europäischen Spitzenliga zu gewinnen.
Die Rolle als Spieler ist eine – wenn auch wesentliche – Rolle im Leben des Martin Stranzl. Was bedeutet ein Leben als Legionär mit Familie für die Familie?
Es gab Momente in meinem Profidasein, die mich zum Nachdenken brachten. Ein banales Beispiel: Am Tag der Erstkommunionsfeier meines Sohnes, zu der die gesamte Familie nach Deutschland kam, setzte der Trainer mitten in einer Länderspielpause trotz spielfreiem Wochenende plötzlich zwei Trainingseinheiten an. Eine Ausnahme gab es für keinen Spieler. Da denkst du dir schon deinen Teil, bist enttäuscht und sauer. Solche Entscheidungen wirken im Verhältnis Trainer-Spieler nach, denn sie zeigen ganz klar, wie mit dir als Mensch in dieser spezifischen Situation umgegangen wurde.
Einmal abseits der Sonnenseite als Fußballprofi in einer der besten Ligen der Welt. Welche Entbehrungen bringt der Beruf eines Fußballprofis mit sich?
Natürlich gab es Entbehrungen, aber um Gottes willen – als Profifußballer geht es einem extrem gut. Wiegen diese Vorteile den Verzicht auf? Im Freundeskreis gab es manchmal schon ungläubiges Staunen, wenn ich wieder nach einer Stunde die Party verließ. Es entsprach meiner Haltung und Einstellung stets professionell zu arbeiten. Das größte Gut ist unsere Lebenszeit. Als Spieler wollte ich mir nie den Vorwurf machen, nicht ausreichend in meine Karriere investiert zu haben. Das versuche ich auch heute als Trainer den Spielern mitzugeben. In der Zeit nach der aktiven Karriere kann man sich zwar voll und ganz der Familie widmen, die Zeit lässt sich aber nicht mehr zurückdrehen.
Die lukrative Einnahmekarriere als Fußballprofi ist kurz im Vergleich zu einer herkömmlichen Angestelltenkarriere. Ab wann beginnt man sich über die sogenannte „zweite Karriere“ ernsthaft Gedanken zu machen?
Als Profi hast du rund zehn, vielleicht fünfzehn gute Jahre, in denen du für die sogenannte „Karriere danach“ vorsorgen solltest. Das setzt voraus, dass man in der aktiven Zeit finanziell vernünftig haushaltet und nicht die ganze Kohle für Statussymbole und Luxus verprasst. In Österreich wurde in der Debatte um den im Kollektivvertrag festgeschriebenen Mindestlohn für Profifußballer auch ich einmal gefragt, nach welcher Methode dieser überhaupt ermittelt wurde und wie die Verantwortlichen auf diese Zahlen kamen.
Mit dem Berufsleben eines Profifußballspielers setzte ich mich sehr viel auseinander. Das bestand nicht nur aus dem Training und Match am Wochenende, sondern ist deutlich vielfältiger. In der Regel war ich 90 Minuten vor dem eigentlichen Trainingsstart am Gelände, zog mein individuelles Programm durch. Nachher folgten Interviews, Meetings mit einzelnen Spielern oder die Videoanalysen zum letzten Spiel bzw. die Vorbereitung auf den kommenden Gegner. Ehrlicherweise war in dieser aktiven Karrierephase nicht allzu viel Zeit für die „zweite Karriere“ zu planen.
Generell ist es ein enorm wichtiges Thema für Profis, sich konkrete Gedanken über die eigene Zukunft nach der Karriere zu machen. Es geht dabei aber nicht nur ums Geld. Ich sehe das gesamtheitlich im Sinne von „was auf einen alles zukommt“, sobald die Spielerkarriere endet. Das beginnt bei den Auswirkungen auf den Körper und beinhaltet auch mentale und psychologische Aspekte.
Ein Teil davon ist die berufliche Perspektive, um jene Interessensfelder zu identifizieren, die einen erfüllen und auslasten können. Wenn jemand am jeden Wochenende das Scheinwerferlicht gewöhnt ist und vielleicht diese Aufmerksamkeit auch als wichtig für sein Selbstwertgefühl empfindet, kann es für einen Ex-Profi schwierig werden. Diese professionelle Nachbetreuung ist ein weißer Fleck und wäre heute umso wichtiger.
Solange du als Profi funktionierst ist alles gut. Wenn es nicht mehr passt, kommt ein neuer Spieler zum Zug. Gut möglich, dass dieses Denken dazu geführt hat, dass wir heute kaum noch den Wert von Vereinstreue kennen. Das fängt bei der sportlichen Führung an, die zwar die Identifikation mit Verein und Fans von den Spielern einfordert, im Halbjahresrhythmus aber am Kader herumschraubt. Wenn du diesen Wert nicht selbst vorlebst, machst du dich in den Augen der Spieler unglaubwürdig. Das sehe ich als eine schwerwiegende Problematik im heutigen Fußball.
Du hast Dir schon als aktiver Spieler ein unternehmerisches Standbein mit 2.0 Automotive aufgebaut. Warum hast Du Dich für diesen Schritt entschieden?
Die Autowerkstatt als zweites Standbein entstand aus meiner Affinität für Autos und meiner Unzufriedenheit mit dem Service vorhandener Firmen. In den letzten beiden Jahren meiner Profikarriere knüpfte ich an meine kaufmännische Ausbildung in der Handelsakademie an, um mein wirtschaftliches Wissen in der Praxis anzuwenden. Dabei spielte auch der Gedanke eine Rolle, als Familie in Deutschland zu bleiben und das Geschäft für die Zeit nach der Karriere aufzubauen. Glücklicherweise fand ich mit meinem Geschäftspartner Sebastian Küppers jemanden, der die Werkstatt in Düsseldorf operativ leitet. Später entschied ich mich für das Trainerwesen, bin aber nach wie vor Mitgesellschafter des Unternehmens.
Wurden damals den Themen Geld und Finanzen unter den Spielern eine Bedeutung beigemessen?
Der Mythos vom Ex-Profikicker, der für den Rest seines Lebens finanziell ausgesorgt hat, hält sich hartnäckig. In Wahrheit sind es nur vier bis fünf Prozent, auf die diese glückliche Situation zutrifft. Es gibt zahlreiche Gefahren für Fußballer, die sie finanziell in Probleme bringen können – etwa dubiose Finanzberater, die die Flucht in Alkohol oder Spielsucht fördern, weil die Drucksituationen kaum anders bewältigt werden können. Rückblickend braucht es wie in vielen Lebensbereichen eine gute Menschenkenntnis, wenn man über den Umgang mit Geld spricht. Auch ich habe Fehler gemacht und den einen oder anderen Finanzberater verschlissen, bis ein Lerneffekt eintrat. Heute setze ich auf eine breitgestreute Anlagestrategie und verspüre kein Verlangen, die letzten Prozente aus jedem Investment herauszukratzen. Damit kann ich ruhigen Gewissens schlafen.
Du hast als Aktiver nie in Österreich gespielt. 2018 folgte die Rückkehr ins Südburgenland. Welche Rolle spielt das Burgenland für Dich bzw. euch als Familie? Welche Bedeutung misst Du Deiner burgenländischen Herkunft bei?
Ich bin schon immer ein sehr heimatverbundener Mensch gewesen. In der Zeit in Moskau, wo wir den Grundstein für unsere junge Familie legten, spürte ich dieses Heimatgefühl deutlich stärker als zuvor in Deutschland. Als Legionär war es für mich immer eine persönliche Verpflichtung, die Farben Österreichs im Ausland würdig zu vertreten, wobei dies, so nach meinem Empfinden, von offizieller Seite im Burgenland kaum wahrgenommen wurde.
Der Entschluss, zurück ins Burgenland zu ziehen, basierte auf der Entscheidung, wieder in der Nähe unserer Familie und Freunde zu sein. Dieses ständige „Immer schneller, immer weiter“ in der Stadt war uns am Ende zu viel. Hier im Burgenland ist das Leben entschleunigend. Nach 20 Jahren im Ausland wirkte es auf uns so, als ob die Zeit daheim stehengeblieben wäre – was in unserem Fall kein Nachteil ist.
Wie beurteilst Du das Vereinssterben im Burgenland?
Der Standortnachteil im Südburgenland ist offensichtlich, da viele Freunde von uns lange Wege in die Arbeit in Kauf nehmen müssen. Viele ehemalige Mitschüler haben noch einen Zweitwohnsitz in ihrer ursprünglichen Heimat, weil es beruflich außerhalb der Tourismusbranche kaum passende Jobs gibt.
Um dem Vereinssterben entgegenzuwirken, sollten zunächst die wirtschaftlichen und infrastrukturellen Voraussetzungen verbessert werden, beispielsweise durch einen schnelleren Anschluss an die Städte Wien und Graz. Wenn wir die Leute im Ort halten können, wächst die Basis an Ehrenamtlichen, die sich im Verein engagieren.
Seit dem Karriereende 2016 hast Du Dir einiges im Fußballgeschäft angesehen: vom Nachwuchstrainer in Gladbach über die Rolle als TV-Experte bei Sky Sport Austria bis hin zuletzt in der Akademie des GAK tätig. Welche Facetten des Fußballs interessieren Dich nach diesen unterschiedlichen Stationen heute am meisten? Wohin soll Dich die Reise in Zukunft hinführen?
In den letzten neun Jahren hatte ich viel Spaß am Platz zu sein und direkt mit den Spielern zu arbeiten. Durch die unterschiedlichen Stationen gewann ich viele Einblicke, konnte dabei jedoch meine Erfahrungswerte in die täglich Arbeit einbringen. In der Ausbildung sollten wir auf grundlegende Themen wie Fitness durch polysportives Training fokussieren. Gleichzeitig im Fußball das spielerische Elemente in die Einheiten stärker betonen, damit der Nachwuchs eine möglichst hohe Anzahl an Ballaktionen im Training erreicht. Bis zum 17. Lebensjahr saugen die Spieler eine Vielfalt an Inputs auf, danach wird sich weisen, ob es in Richtung Profisport geht. Das übergeordnete Ziel muss es sein, die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit der Breitensport wächst. Denn letztlich profitiert der Spitzensport von einer erweiterten Basis.
Die Nachwuchsförderung ist das stabilste Säule – auch wenn das die Vereine erst erkennen, wenn ihnen die Kohle ausgeht oder teure Transfers floppen. In der oberen Ebene entscheiden zum Teil Verantwortungsträger, die über die Materie wenig bis gar keine Ahnung haben, aber meinen zu wissen wie es zu funktionieren hat. Ich musste es selbst erleben, wie wenig Unterstützung die Trainerbasis erhält. Daher habe ich meinen Entschluss gefasst, in einen Bereich zu arbeiten, wo ich selbst gestalten kann. Auch deshalb schloss ich heuer den Lehrgang „Diplom Fußballmanager“ am Bundesliga-Campus ab. Mein Gesamtpaket aus professioneller Ausbildung, Trainerpraxis und gelebte Spielererfahrung sehe ich als einen Vorteil, um Strukturen im Verein zu schaffen, ein erfolgreiches Team zusammenstellen, das eine gemeinsame langfristige Vision teilt.
Sautanz -Word-Shuffle
Glück
Glück ist der Zufall, der auf Bereitschaft trifft.
Ehrgeiz
Stärke von mir, darf nicht in Perfektionismus ausarten.
Fischen
Eine große Leidenschaft. Es geht mir weniger um das Fangen eines Fischens, sondern um die Natur und Ruhe, die mit dieser Aktivität verbunden sind.
Heavy Metall
Als Spieler und noch heute beim Trainieren die bevorzugte Begleitmusik.
KFZ-Mechaniker
Gibt‘s leider nicht mehr viele gute 😊
Sautanz
Kenne ich von früher noch. Beim Großvater kamen zur Hausschlachtung alle zusammen und das Schwein wurde komplett verarbeitet. Das Ereignis hatte früher sein eigenes Flair.
Hier geht es zu den anderen Teilen der Serie:
Burgenlands Fußball-Legionäre – ein Quintett von Schottland bis Zypern (Teil 1)
Welche Erinnerungen habt ihr an Martin Stranzl? Teilt uns gerne eure Meinung zu diesem Interview in den Kommentaren mit!
🗨 Kommentare ( 1 )





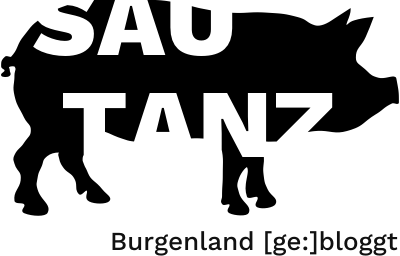
1ag2rh