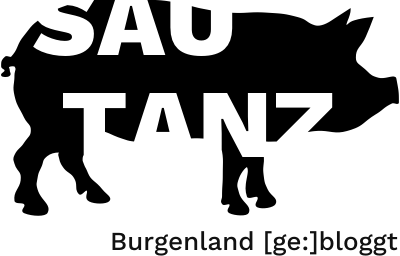Mit einem Überlebenskünstler setzen wir unsere Serie über die Säugetiere im Burgenland fort: mit dem Feldhasen (Lepus europaeus), also richtigerweise mit dem Europäischen Feldhasen.

von Franz Lex
Hierzulande wird er schlicht Hase genannt. Der Hase ist ein Säugetier der Ordnung der Hasenartigen aus der Familie der Hasen, zu denen auch der in Österreich lebende Alpenschneehase und das im Nordburgenland vorkommende Wildkaninchen gehören.
Hasen sind keine Nagetiere
Die Hasenartigen, die lange den Nagetieren zugerechnet wurden, unterscheiden sich aufgrund verschiedener Merkmale – Schädelaufbau, Bezahnung und Bau der Hinterbeine – von diesen, obwohl ihre Schneidezähne wie bei Nagetieren nachwachsen.
Der Kulturfolger ist ein Wiederkäuer
Der scheue und meist dämmerungs- und nachtaktive Feldhase besiedelt als Einzelgänger Wiesen, Äcker und Wälder, deren Bestand durch Monokulturen und Straßenverkehr in den letzten Jahrzehnten deutlich geschrumpft ist. Die Nahrung besteht aus Gräsern, Kräutern, Feldfrüchten, Zweigen, Baumrinde und Wurzeln, von der in Ruhephasen überwiegende Teile vorverdaut ausgeschieden und wieder aufgenommen werden, um Nährstoffe besser verwerten zu können.

Bei der Futteraufnahme (Äsung) sitzt der Hase gut getarnt in der Vegetation und sichert mit Augen und fast angelegten Ohren die Umgebung ab, wobei ein Ohr zur Seite und das zweite nach oben gerichtet Geräusche aufnehmen können.
Ein Sprinter und gefinkelter Marathonläufer
Besonders gut ausgebildet sind beim Feldhasen der Geruchssinn und durch die langen Ohren (Löffel – in der Waidmannssprache) der Gehörsinn. Die seitlich hervorstehenden Augen (Seher) ermöglichen ihm einen Rundumblick, um Feinde am Boden und in der Luft wahrzunehmen. Mit den jahreszeitlich unterschiedlichen braunen und grauen Schattierungen im Fell, das zweimal im Jahr gewechselt wird, ist er gut getarnt, wenn er sich bei Gefahr in eine Bodenmulde drückt oder im flachen, selbst gescharrten Liegeplatz (Sasse) ruht. Auffallend lange Beine (Läufe) ermöglichen ihm als Sprinter und Langstreckenläufer mit bis drei Meter weiten Sprüngen eine Geschwindigkeit von ca. 70 km/h zu erreichen. Er schlägt auch 90-Grad-Haken. Bei großer Gefahr gibt er durchdringende, quiekende Laute (Klagen) von sich. Feldhasen warnen einander durch Klopfen (Trommeln) mit den Hinterbeinen (Sprünge).

Freie Flächen, wie Straßen, Wege, gemähte Wiesen und kahle Äcker werden mit aufgestellten Ohren in hoher Geschwindigkeit überquert, wobei mit den hervorstehenden Augen auch nach hinten abgesichert wird.

Für eine Äsungspause wird an einem passenden Platz die Umgebung beobachtet, die Ruhehaltung eingenommen und die Ohren in Zeitlupe angelegt.
Viele Jäger sind des Hasen Tod
Der standorttreue Feldhase und sein Nachwuchs haben viele natürliche Feinde, wie Wildschwein, Fuchs, Dachs, Marder, Iltis, Uhu, Habicht, Krähe etc.

Die Schmusekatze, die den ganzen Tag müde herumliegt, frisst, trinkt, schnurrt, spielt, schläft und den Anschein erweckt, als könnte sie niemandem ein Haar krümmen, wird am Abend und in der Nacht gemäß ihrem Naturell zur Bestie, die (Jung)Vögel, Reptilien, Insekten, Frösche und Kleinsäuger in „ihrem“ Jagdrevier in der Größe von einigen Hektaren tötet und vertilgt bzw. im Ganzen (oft noch lebend bzw. verletzt) oder Teile davon vor der Eingangstüre auf dem Fußabstreifer ablegt.
Die größten Gefahren gehen von den drei berüchtigten HHH´s aus: streunende Hunde, verwilderte, ausgesetzte und in der Nacht herumlaufende Hauskatzen und Homo sapiens, der durch
- Aufräumen der „unordentlichen“ Landschaft,
- Anlegen von riesigen Kulturflächen (Entfernen der Ackerraine und Feldgehölze),
- Zerschneidung von Landschaften durch Straßen und Wege,
- Häckseln, Schlegeln und Mulchen (statt Mähen mit naturschonenden Geräten) von Kulturflächen, (Streuobst)Wiesen und Böschungen und
- Mähen von Wiesen mit Kreiselmähwerk (statt Fingerbalkenmäher und Doppelmessermähwerk)
den Lebensraum inkl. Deckung und das Nahrungsangebot zerstört, und die natürlichen Feinde haben ein leichtes Spiel.
Rotierende Mähwerke bedeuten einen höheren bzw. den kompletten Verlust der Wiesenfauna. Durch den entstehenden Sog und die hohe Geschwindigkeit haben Insekten, Spinnen, Erdkröten, Frösche, Reptilien, bodenbrütende Vögel, junge Feldhasen und andere Kleinsäuger keine Chance. Außerdem entsteht bei Pflanzen ein gefranster und kein glatter Schnitt, der die Regeneration und die Entwicklung der Deckung für Hasen erheblich verzögert.
Mutter Natur findet immer Wege und Mittel
Die Rammelzeit– wie die Zeit der Paarung der Feldhasen auch genannt wird – beginnt schon im Januar und dauert bis in den Herbst. Die Hauptpaarungszeit ist im April und Mai. An dem Paarungstreiben, bei denen die Männchen (Rammler) in Boxkämpfen und wilden Verfolgungsjagden um die Gunst der Weibchen (Häsinnen) buhlen, beteiligen sich auch die Weibchen.
Um gegen die vielen natürlichen Feinden eine Chance zu haben, können Häsinnen während der Tragezeit von ca. 42 Tagen erneut trächtig werden. Dieses Phänomen wird Superfetation (Doppelträchtigkeit) genannt – mit Embryonen unterschiedlicher Entwicklungsstadien. Dadurch ist es möglich, dass sie 3 bis 4 Mal jährlich je 1-5 Junge (Satz) zur Welt bringen, die von verschiedenen Vätern stammen können, da sie sich innerhalb kürzester Zeit mit verschiedenen Rammlern paaren (Inzucht?). Junge Feldhasen sind Nestflüchter, d.h., sie werden behaart und sehend geboren und können laufen, im Gegensatz zu ihren Verwandten, den Wildkaninchen, die Nesthocker sind und nackt und blind in einem Bau geboren werden. Trotz einer Lebenserwartung von ca. 12 Jahren werden Feldhasen in freier Wildbahn durchschnittlich 1 bis 4 Jahre alt.

Das Hauskaninchen ist die domestizierte Form des Wildkaninchens.
Albrecht Dürer & Co.
In Kunst und Kultur ist der Feldhase ein sich wiederholendes Motiv. Albrecht Dürers Aquarell „Feldhase“ ist eines der bekanntesten Tierporträts der Kunstgeschichte, das als naturgetreu und lebensecht beschrieben wird.
Der Hase hat in verschiedenen Kulturen verschiedenste Bedeutungen und Verwendungen:
- Symbol für Fruchtbarkeit, Sinneslust, Leben, Tod, Schnelligkeit, Wendigkeit, Leichtigkeit, Anmut, Eleganz, Artenschutz
- Bote des Frühlings, denn er ist eines der ersten Tiere, die schon früh im Jahr Nachwuchs bekommen und zu Ostern Eier bringen, die ebenfalls für Fruchtbarkeit stehen.
- Sinnbild von Lebenskraft, Wiedergeburt und Auferstehung im Zusammenhang mit dem christlichen Osterfest
- Verwendung in der Modewelt
- Märchen: Der Hase und der Igel
- Darstellung als Jagdtier; Treibjagden gibt es kaum noch.
Die Waidmannssprache, die traditionelle Fachsprache der Jäger, wird zur Verständigung untereinander und als Teil des jagdlichen Brauchtums benutzt.
Viele Redewendungen werden (fast täglich) verwendet:
Angsthase, Hasenfuß – ängstlicher, feiger Mensch
Hasenscharte (soll nicht verwendet werden) – Lippen-Kiefer-Gaumenspalte
Mein Name ist Hase – von nichts wissen, unschuldig
Einen Haken schlagen – plötzlich die Richtung ändern
Wissen, wie der Hase läuft – Ahnung haben, sich gut auskennen
Ein alter Hase sein – Erfahrung von Dingen haben
Wo sich Fuchs und Hase „Gute Nacht“ sagen – abgelegener Ort, Idyll
Da liegt der Hase im Pfeffer – das ist der Knackpunkt, worauf es ankommt, der Kern des Problems
Zum Thema passend gibt es ein Rezept für eine traditionelles Gericht:
Falscher Hase mit Rotkraut und Bratkartoffel
Vorspeise: Griesknödelsuppe (nachhaltige Knochenverwertung)
Der Name „Falscher Hase“ stammt aus der Nachkriegszeit, in der sich viele Familien einen echten Hasen für ein Festessen zu Ostern nicht leisten konnten. Ein Faschierten Braten wurde zu einem Hasenrücken geformt, und so entstand die Bezeichnung „Falscher Hase“.
Für unser Gericht wird eine hintere Schafskeule im Ganzen bei einem unserer Direktvermarkter besorgt.
Die ausgelösten Knochen in einem Topf mit Wasser aufgefüllt mit Wurzelgemüse (Sellerie, eine große Karotte im Ganzen), einer kleinen Zwiebel, drei Knoblauchzehen, zwei Lorbeerblättern, Thymian, einigen Pfeffer- und Wacholderkörnern, grünen Ysop- und Liebstöckelblättern ca. zwei Stunden bei leichter Hitze kochen lassen.
Griesknödelmasse richten und in den Kühlschrank stellen.
Die Zutaten werden absichtlich ausgiebiger genannt, da sich die nicht verspeisten Stücke des „Falschen Hasen“ hervorragend zum Einfrieren im Ganzen eignen, denn die Vorbereitungen und Arbeitsschritte erfordern doch viel Zeit und einen großen Aufwand!
- 1,5 kg Faschiertes (Rind, Schaf oder Schwein, kann auch gemischt sein)
- 1 kg Knödelbrot
- 5 Eier
- ¼ l Milch
- 3 Zwiebeln
- 5 Knoblauchzehen
- Salz
- Pfeffer
- Koriander
- Muskatnuss
- verschiedene grüne Kräuter vom Küchengarten: Petersilie, Sellerie, Liebstöckel, Thymian, Bohnenkraut und Ysop (oder getrocknet bzw. gefroren)
- Öl/Fett
- Kartoffeln je nach Anzahl der Personen
Zwiebeln und Knoblauch schälen und schneiden. Zwiebeln in Öl/Fett anrösten, danach Knoblauch mitrösten und auskühlen lassen. Kartoffeln in einem Topf mit Wasser aufgießen und weichkochen. 4 Eier in siedendem Wasser 10 min. hart kochen. Kräuter hacken und Schnittlauch für die Suppe schneiden. Eier, die Karotte in der Suppe und Kartoffeln zwischendurch rausnehmen und abkühlen lassen.
Das Fleisch durch den Fleischwolf drehen und in einer größeren Schüssel mit allen Zutaten gut vermengen. Das Ganze einige Zeit ziehen lassen. Währenddessen werden die Eier geschält und die Böden von zwei länglichen Bratpfannen (mit Deckel) mit Öl/Fett bestrichen. Das Backrohr wird auf 220 Grad vorgeheizt. Die Hälfte der Masse wird nach nochmaligem Durchmengen ca. 15 cm breit und 3 cm hoch in den Pfannen aufgetragen.
Jetzt kommt das Versteckspiel: In eine Pfanne werden die ganzen Eier der Länge nach hintereinander und in die andere die ganze Karotte in die Mitte gelegt und mit der restlichen Masse abgedeckt. Mit den Rücken von zwei Esslöffeln wird die Masse mit Inhalt zu zwei „Hasenrücken“ geformt, und die zugedeckten Pfannen ins Rohr geschoben. Während der Bratzeit von 20 min. bei 220 Grad und 40 min. bei 200 Grad werden
- die Suppe abgeseiht, mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt und die Grießknödel eingekocht,
- im Winter eingekochtes Rotkraut aus dem Glas in einen Kochtopf geleert und aufgewärmt und
- die Kartoffeln geschält, je nach Größe geviertelt oder geachtelt und in einer größeren Pfanne in Öl/Fett gebraten.
Im „Falschen Hasen“, auch bekannt als „Stefaniebraten“, können neben Eiern und Karotten auch Essiggurken versteckt werden. Die Masse kann mit Eiern auch zu Kugeln und Karotten und Essiggurken zu Stangerln geformt werden.

Falscher Hase Preiselbeeren serviert: Ein Genuss!
hier geht es zu den weiteren Teilen der Serie
🗨 Kommentare ( 0 )